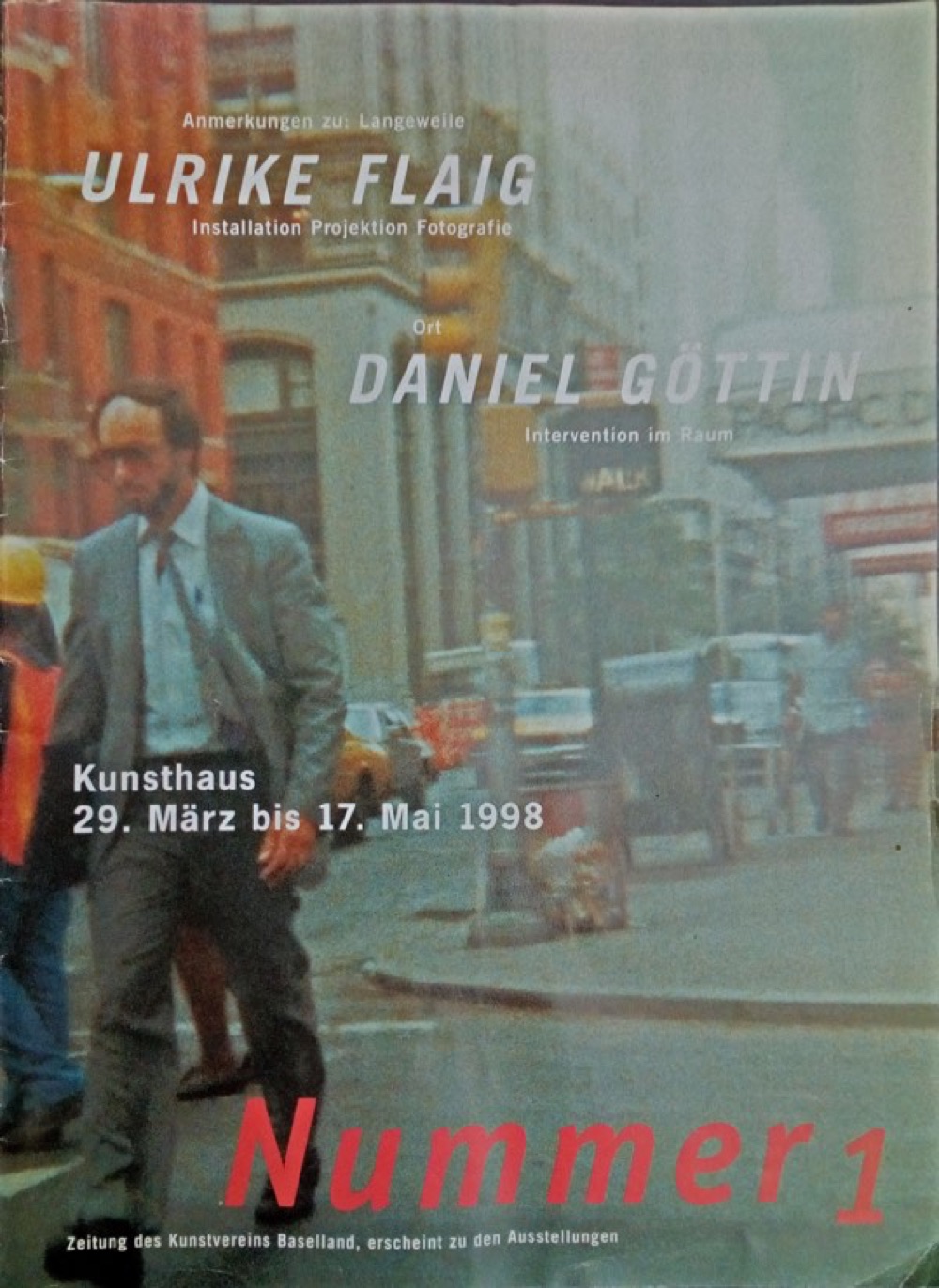Ulrike Flaig
Anmerkungen zu: Langeweile
29.3. —
17.5.1998
Ulrike Flaig ist Grenzbestimmerin und Gratwanderin auf vielen Ebenen. Sie tritt bis an die Grenze heran, definiert die Grenze an sich, ohne den Übertritt von einem Medium ins andere zu vollziehen. Sie geht an die Grenze, indem sie alles, was nicht zum Wesentlichen gehört, weglässt. Sie arbeitet an der Peripherie und rückt ins Zentrum, was an den Rändern war. In der Balance zwischen Peripherie und Zentrum schafft sie Zwischenzustände von beeindruckender Fragilität. Sie vollendet nichts, sondern setzt sich und dem Betrachter beständig dem Risiko der Erkenntnis aus.
Auf den ersten Blick verblüfft die frugale bis spartanische Aufmachung der Arbeiten von Ulrike Flaig. Dinge, wie zufällig arrangiert, begegnen sich und dem Betrachter auf überschaubarem Raum. Materialien ohne Materialwert, Zusammengebautes, Zusammengedachtes führen eine scheinbar beziehungs- und absichtslose Existenz. Neben Dingen des alltäglichen Lebens bevorzugt die Künstlerin Materialien, die Transparenz erzeugen: Glas, Plexiglas, Plastikfolien. Bei näherem Hinsehen ziehen sich durch die Arrangements die Spuren des Herstellungsprozesses: Spucke klebt auf einem Glas, halbe Klebestreifen führen eine rätselhafte, über ihre Vergänglichkeit hinausweisende und doch haltlose Existenz. In lustvoll gedrehte Rotznasen drückt sich wenig appetitanregend ein Fingerabdruck. Überall sind Werden und Vergehen und die Prozesshaftigkeit des Machens sichtbar belassen und gerade nicht in der hermetischen Geschlossenheit eines Werkes aufgehoben.
Auf topographischer, formaler und inhaltlicher Ebene sind alle Arbeiten nach den Rändern hin offen, dabei den Zufall als sicheren Gestaltungsfaktor mit einkalkulierend. Ganz offenkundig ist die Künstlerin Inszenator eines Theatrum mundi. Sie platziert ein ausgedientes Netz, eine einfache Flasche an einen unverrückbaren Ort, ohne dabei in geschauspielerten und rhetorischen Gesten zu erstarren. Zugleich zieht sie sich aber zurück bis an den Rand ihrer fragilen Objekte und der Bezugswelten ihrer Installationen und zwar zurück auf die Oberfläche der Dinge als Erscheinungen, die in einem weiträumigen Sinne Assoziationen verschiedenster Art evozieren. Auf dieser Oberfläche kann Ulrike Flaig tanzen, die Dinge auf den Kopf stellen, aus der Balance in die Schwerelosigkeit bringen; Dinge durch Wind, Wellen und Sonne treiben, sich spiegeln und im Lichte zersetzen lassen.
Licht als Materie ist eines der wichtigsten Gestaltungsinstrumente in den neueren Werkkomplexen. Es setzt die Dinge in Beziehung zueinander und die Bedeutungen ausser Kraft. Es nimmt verschiedene Erscheinungsformen an: Als gefiltertes Licht erscheint es in Gestalt lichtdurchlässiger Plexiglasscheiben, die das Licht in milchige, nuanciert abgestufte Töne zerlegen, als Projektion in Form von Dias und bewegten Bildern und als Spiegelung, wie in der Tageslichtstrecke, entstanden als Jahresgabe für den Württembergischen Kunstverein 1997. In diesem Objekt steht eine schnurgerade, ohne definierten Anfang und Ende gezogene, mehrfach duplizierte Linie als sichtbar gemachte Lichtspur für die verfliessende Zeit. Ob gefiltertes Licht, Projektion oder Spiegelung, im einen wie im anderen Falle wird Licht in seiner körperlosen Oberflächenerstreckung manifest, an der entlang die Eigenschaften der Dinge an ihrer Wirkung ablesbar werden.
Das Licht, wie Ulrike Flaig es in ihren Arbeiten einsetzt, definiert Wahrnehmung unter veränderten Vorzeichen. Nach der tradierten Überzeugung in der europäischen Kunstgeschichte werden Dinge und räumliche Ausdehnung erst durch das Licht fassbar. Licht und Schatten dienen als Abgrenzungsphänomene und als Massgabe perspektivischer Tiefenerstreckung im fluchtpunktorganisierten Raum. Genau entgegengesetzt dazu verhält sich Licht bei Ulrike Flaig, denn es markiert kein Tiefenphänomen mehr, sondern materialisiert sich in seinen verschiedenen Erscheinungsformen als Oberfläche und/oder Grenze, an der die Dinge von einer Existenzform in die andere treten, bzw. auf zwei Seiten verteilt und daran entlang wieder vereinigt werden. Das bedeutet. dass die durch Licht ermöglichte Wahrnehmung für die Künstlerin nicht mehr primär optischer Natur ist. Im Umgang mit Licht begründet sich zwar ein vorherrschendes ästhetisches Prinzip ihrer Arbeit, es besitzt aber zugleich eine ambivalente inhaltliche Dimension und reflektiert genau jenen Kippmoment und Zwischenzustand, der ihre Arbeiten auszeichnet. die sich stets in verschiedene semantische Ebenen auffächern. Auf raffinierte Art und Weise bedient sich die Künstlerin der ambivalenten Funktion des Lichts in Bezug auf die verwendeten Gegenstände. Das Naturlicht dient dazu, die Dinge zu zeigen, wie sie sind; das inszenierte Kunstlicht führt hingegen den Betrachter in einem sprichwörtlichen Sinne «hinters Licht». Bestes Beispiel hierfür ist der Potsdamer Platz, eine installative Raumarbeit von 1996: Vor ein aus Becken aufgebautes Gerüst mit quergelegten Latten, das sowohl Lampen als auch verschiedene Dinge trägt. stehen zwei Plexiglasscheiben, hinter denen das Konglomerat von Gegenständen im diffusen Licht-Schattenspiel wie ein Baustellenambiente wirkt. Von vorne betrachtet erscheint der Platz als Bühne, wobei die Vorderseite zugleich die Erscheinungsseite der Dinge bildet. Die Rückseite birgt Ernüchterung angesichts eines glanzvollen, in mysteriöses Licht getauchten Auftretens, verbunden mit Heiterkeit als Ausdruck eines Erkenntnisprozesses auf Seiten des Betrachters. Weder Vorder- noch Rückseite bestehen für sich allein, an der Oberfläche jedoch, d.h. an den zwischengeschobenen Plexiglasscheiben, dort, wo das Licht sich bricht, findet der entscheidende künstlerische Moment statt.
An dieser Arbeit offenbart sich die Arbeitsstrategie der Künstlerin, die mit dem Prinzip von Umkehrungen, Dualitäten und Ambivalenzen das Problem von Abbild und Scheinbild, von Ding- und Erscheinungswelt und damit verbunden einer poetischen Erinnerungswelt thematisiert. Dabei bleibt der Begriff des Trugbildes ausgeklammert, denn Trugbilder sind es keineswegs, die da an die Oberfläche steigen, denn das, was zu sehen ist, will nicht mehr sein, als das, was es ist. Aus dieser Beobachtung folgert, dass es demnach keine feststehende Wahrheit mehr geben kann. Die alten Kategorisierungen von Abbild und Trugbild und die Einschätzung dessen, was wahr und was falsch ist, sind in der Welt der Erscheinung aufgehoben. Die Projektion auf der Fläche ist Entwurf und Scheinwahrnehmung zugleich, denn die Dinge werden ihrem vermeintlich wahren Wesen entfremdet, indem sie zur Projektion ihrer selbst werden. Gleichzeitig können sie aber dadurch eine zusätzliche, für jeden Betrachter unterschiedliche, individuelle Dimension gewinnen.
Ulrike Flaig arbeitet mit höchst banalen Dingen, die eine unspektakuläre Existenz führen: eine Tüte, ein Netz, eine Plastikflasche. Es sind Dinge, denen sich bestimmte Erfahrungen und Namen zuordnen lassen, die aber in der Welt der Erscheinung fragwürdig geworden sind. Die Dinge haben ihre feststehende Qualität verloren und können nicht mehr Ausdruck sozialer Handlungen sein. Sie sind Ursache und Wirkung in einem, auch wenn zweifelsohne schon das Material als solches die Künstlerin zur Auseinandersetzung reizt. Das Ding besteht vor allem in seiner Beziehung zur Welt und nicht mehr in körperlicher Unverrückbarkeit oder eindeutiger Wesensbestimmung. Es definiert sich in Paradoxa, Dualitäten, Ambivalenzen und Widersprüchen. Das statische ist einem dynamischen Prinzip gewichen, die Dinge lassen sich nur beschreiben, wenn man ihrer Eigenschaften, die sich auf der Oberfläche entfalten, habhaft wird. Dennoch, diese Art von Kunstauffassung ist vom Ansatz her nicht konzeptionell, sondern sehr konkret, denn Ulrike Flaig kommt vom Ding her, das alles beinhaltet, was Welt ist oder sein kann. Insgeheim hat sie den Glauben an die Dinge nicht verloren, eine unauflösliche Beziehung zum Faktischen lässt sie immer wieder auf die Welt der vermeintlich feststehenden Tatsachen zurückgreifen: Was wäre die Welt, wenn nicht wenigstens auf Flaschen, Netze und andere Dinge Verlass wäre?
In dem Ansatz von Ulrike Flaig spiegelt sich eine der wesentlichen philosophischen Grundanschauungen des 20. Jahrhunderts. Deleuze hat sie in seiner Theorie der Falte, bzw. der Faltung formuliert und in seinen Untersuchungen zur «Logik des Sinns» dargelegt. Aus der Abwägung des platonischen Ideenmodells gegenüber der stoizistischen Auffassung zweier Arten von Dingen leitet er eine «Kritik der Tiefe» zugunsten einer Theorie der Oberfläche ab: «Die Folgen sind ausserordentlich bedeutsam. Bei Platon nämlich fand in der Tiefe der Dinge, in der Tiefe der Erde ein obskurer Streit statt zwischen dem, was sich dieser Aktion der Idee unterwarf, und dem, was sich dieser Aktion entzog (die Abbilder und die Trugbilder). Ein Echo dieses Streits klingt noch in der Frage des Sokrates nach: Gibt es eine Idee von allem, selbst noch vom Haar, vom Schmutz und vom Dreck oder aber gibt es etwas, das unentwegt und beharrlich der Idee ausweicht? Nur war bei Platon dieses Etwas nie ausreichend genug in die Tiefe der Körper verschüttet, verdrängt, abgewehrt, nicht tief genug im Ozean versenkt. Nun steigt alles wieder auf die Oberfläche. Das ist das Ergebnis des stoizistischen Unternehmens: Das Unbegrenzte steigt wieder auf. [...] Es handelt sich nicht mehr um Trugbilder, die sich aus der Tiefe lösen und überall einschleichen, sondern um Wirkungen, die sich offenbaren und an ihrer Statt gelten. Wirkungen im kausalen Sinn, aber auch Ton und optische ‹Effekte›, Sprachwirkungen und noch weniger oder weit mehr, da sie nichts Körperliches mehr an sich haben und nun ganz ideell sind [...]. Was sich der Idee entzog, ist an die Oberfläche, unkörperliche Grenze, gestiegen und repräsentiert nun die ganze mögliche Idealität, die jede kausale und geistige Wirkungskraft verloren hat. Die Stoiker haben die Oberflächenwirkungen entdeckt.» (Gilles Deleuze) Diese Oberflächenwirkungen folgen nicht mehr linearen Prinzipien, sondern auf der Ebene der Tatsachen, um die es auf der Oberfläche des Seins geht dem Paradoxon des Absurden und Unmöglichen, dem Prinzip der Dualität und des Widerspruchs. Der Dingzustand beinhaltet dabei die Freiheit der Organisation, die sich auf der Grenze, der «Oberfläche», zwischen Sinn und Unsinn ereignet.
Über den Arbeiten von Ulrike Flaig liegt ein hintergründiger und feinsinniger Humor, der gelegentlich auch in seiner intellektuellen Variante ironische Züge tragen kann. Er erwächst aus der Differenz zwischen Sein und Schein einerseits und dem Verhältnis zur Sprache in Form poetischer Titel andererseits. Lächeln muss der Betrachter beispielsweise, wenn in Verkehrung von Gross und Klein eines der grossartigsten, jedem passionierten Bergsteiger bekannten Bergpanoramen «Eiger, Mönch und Jungfrau» in Tischvitrinenqualität mit Nadel und Faden auf Styropor nachgesteckt wird; wenn mit kleinen poetischen Randbemerkungen Erinnerungspotential geweckt und Stimmung ausgelöst werden, die in durchaus absurdem Zusammenhang mit sichtbaren Tatbeständen stehen; wenn das Pathos eines «Bakunin geht in sich» mitsamt seiner theatralischen Gebärde an geplatzten Luftballons, zerschellt. «Das Paradox erscheint als Entzug der Tiefe, Entfaltung der Ereignisse auf der Oberfläche, als Entfaltung der Sprache entlang dieser Grenze. Entgegen der alten Ironie als Kunst der Tiefen und der Höhen ist der Humor diese Kunst der Oberfläche.» (Gilles Deleuze). Dieser Satz ist nur vor dem Hintergrund der ursprünglichen, umfassenden philosophischen Qualität des Begriffs «Humor» zu verstehen. Er wird um 1800 relevant für die Ästhethik. Die Exzentrizität und Extravaganz des «humour» als Grundzug der Wahrnehmung, Verhaltensweise und Kommunikation gelten um 1800 als wesentlicher bewusstseinsgeschichtlicher Index der modernen romantischen Einbildungskraft. Er bezeichnet die «Reflexion des Verhältnisses von Realem und Idealern, die Vermittlung von Endlichem und Unendlichem, die Repräsentation des Unendlichen durch die in der Subjektivitat beschlossene, nie vollendete Totalität der Weltaneignung und der Beziehung zur Realität, und schliesslich die Aufhebung aller Begrenztheit und Positivität des Endlichen durch die unendliche Vielfalt subjektiver Brechung des Wirklichen». (Wörterbuch der Philosophie, hrsg. v. J. Ritter, Bd. 3, Darmstadt 1974) In diesem Sinne ist der Humor ohne Schärfe, getragen von Ernst und Liebe und grosser Freiheit des Geistes. Der Humor sieht am Ernsthaften und Grossen das Unbedeutende und Kleine, ohne doch jenes kritisch zersetzend zu verneinen. Umgekehrt sieht der Humor auch am Vernunftwidrigen noch das Vernünftige. (Philosophisches Wörterbuch, hrsg. v. Georgi Schischkoff, Stuttgart, 1991) Der Humor ist eine philosophisch begründete Lebenshaltung. Er versöhnt Ambivalentes und entsteht durch Simultaneität des Gleichzeitigen und des Ungleichzeitigen. Er entsteigt der kleinen Differenz zur Ernsthaftigkeit, einer Differenz zwischen dem Eigentlichen und dem Uneigentlichen. Auf formaler Ebene entsteht er zwischen Ähnlichkeiten und Unterschiedlichem und der gewollten Parallelisierung, bzw. dem Auseinanderklaffen von Bild und Wort. Mehrfache Parallelisierung bildlicher, akkustischer und sprachlicher Natur geschieht beispielsweise, wenn einem ästhetischen Phänomen, angesichts eines drehbaren Löffels, der in einem Metalltopf Spiegelungen mit anamorphotischen Qualitäten erzeugt, ein schabendes, schier unerträgliches Geräusch, ausgelöst durch einen gebogenen, schleifenden Metallstab auf einer Betonplatte, an die Seite gestellt wird und das Ganze als «Anmerkungen zur Langeweile für Eva» tituliert wird. Den Betrachter erreicht der Humor in der Regel mit Zeitverzögerung, dafür aber umso nachhaltiger: Während der graue Metallstift seine enervierenden Runden zieht, breitet sich nach und nach auf den Gesichtern der Betrachter ein verblüfftes und entspanntes Lächeln aus.
Text von Andreas Baur